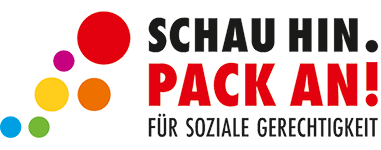Keine Gleichheit für Menschen mit Behinderungen in Deutschland?
Kritik am Fehlen eines einheitlichen Bedarfserhebungsinstruments in der Eingliederungshilfe in Deutschland
Die Kritik am Fehlen eines einheitlichen Bedarfserhebungsinstruments in der Eingliederungshilfe in Deutschland lässt sich weiter vertiefen, indem man spezifische Aspekte betrachtet, die diese Situation komplizieren:
1. Fehlende Einheitlichkeit und Konsistenz:
Regionale Unterschiede: Die Bedarfserhebung wird auf kommunaler und oft auch auf Landesebene durchgeführt, was zu regionalen Unterschieden in der Qualität und dem Umfang der Leistungen führen kann. Jede Region hat ihre eigenen Standards und Verfahren, die in der Regel nicht miteinander abgestimmt sind. Dies führt zu einem Flickenteppich an Vorgehensweisen, bei dem die benötigten Unterstützungssysteme nicht überall gleich gut zugänglich sind. Beispielsweise kann es sein, dass in einer wohlhabenderen Kommune Leistungen großzügiger gewährt werden, während in weniger finanziell starken Regionen die Leistungen weniger umfassend oder spezifisch sind.
Unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen: In Regionen, die weniger Ressourcen haben, kann der Zugang zu benötigten Hilfen erschwert sein, da die Kommunen gezwungen sind, Priorisierungen vorzunehmen und oft nur grundlegende Leistungen bereitzustellen. Diese Diskrepanz kann zu erheblichen Unterschieden in der Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen führen, je nachdem, wo sie leben.
2. Bürokratische Hürden und Ineffizienz:
Vielfältige Antragsteller- und Entscheidungsverfahren: Jedes Bundesland und jede Kommune verwendet eigene Antragsformulare und -verfahren, was zu einer erheblichen Mehrbelastung sowohl für die Antragsteller als auch für die Verwaltung führt. Dies bedeutet, dass Betroffene oft mehrere Anträge stellen müssen, was die Bürokratie für Menschen mit Behinderungen erhöht und ihnen den Zugang zu notwendigen Leistungen erschwert. Eine einheitliche Bedarfsbewertung könnte diese Hürde verringern und einen schnelleren und effizienteren Zugang zu Hilfen ermöglichen.
Doppelte und dreifache Bedarfsermittlung: Oft müssen die gleichen Informationen wiederholt bereitgestellt werden, um verschiedene Aspekte der Eingliederungshilfe zu prüfen. Dies kann zu unnötigem Aufwand führen und die Verwaltungskosten erhöhen. Eine Standardisierung der Bedarfserhebung könnte diese Redundanzen reduzieren und die Effizienz im Umgang mit Anträgen und deren Bearbeitung steigern.
3. Qualitätsunterschiede in den Leistungen:
Intransparente Standards: Aufgrund der dezentralen Verantwortung fehlt oft eine klare und transparente Festlegung von Standards, die definiert, welche Kriterien für die Bedarfserhebung gelten. Dies kann zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, in einer Region kann jemand als „nicht bedürftig“ eingestuft werden, während in einer anderen Region dieselbe Person als bedürftig betrachtet wird. Die Folge ist eine ungleiche Behandlung und eine unsichere Berechenbarkeit für die Betroffenen, was das Vertrauen in das System untergräbt.
Fehlende individuelle Ausrichtung: Durch die mangelnde Standardisierung werden spezifische individuelle Bedürfnisse nicht immer adäquat erfasst. Menschen mit komplexen und multiplen Behinderungen können Probleme haben, ihre spezifischen Hilfebedarfe in den bestehenden Systemen zu kommunizieren. Ein einheitliches Instrument könnte helfen, diese individuellen Bedürfnisse besser zu erfassen und spezifische Leistungen passgenauer anzubieten.
4. Fehlende politische und soziale Akzeptanz:
Politische Fragmentierung: Da die Zuständigkeit für die Eingliederungshilfe zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist, gibt es oft eine zögerliche Bereitschaft auf der politischen Ebene, einheitliche Standards durchzusetzen. Dies liegt an unterschiedlichen politischen und ideologischen Vorstellungen, wie Sozialleistungen geregelt werden sollen. Einheitliche Standards könnten als Eingriff in die Autonomie der Bundesländer wahrgenommen werden, was zu Widerstand führt.
Soziale Akzeptanz: Das Fehlen eines einheitlichen Instruments kann auch zu sozialen Stigmatisierungen führen. Menschen mit Behinderungen könnten aufgrund unterschiedlicher Bedürfnisbewertungen als „wertlos“ oder weniger „wert“ wahrgenommen werden, was die gesellschaftliche Akzeptanz und Integration erschwert.
Diese Aspekte zeigen, dass das Fehlen eines einheitlichen Bedarfserhebungsinstruments nicht nur praktische Probleme wie Bürokratie und Ineffizienz verursacht, sondern auch tiefere soziale und politische Herausforderungen birgt. Eine Standardisierung könnte nicht nur die Qualität und die Zugänglichkeit der Leistungen verbessern, sondern auch zur Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft beitragen.
Sie fühlen sich in Ihrer Denke angesprochen? Sie möchten sich gern politisch engagieren? Dann sprechen Sie uns an und fragen Sie nach unseren Interessengruppen-Vielleicht möchten Sie eine Interessengruppe zur politischen Unterstützung von Menschen mit Behinderung entwickeln?
Marlen Kramer-Hirtz
Bereichsleiterin Eingliederungshilfe