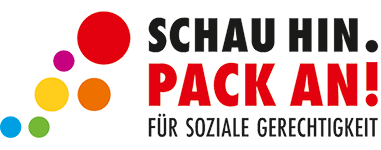Wer in den Bundestag will, muss zuhören!
Pflegekräfte aus dem Harzkreis teilen ihre Erfahrungen und Erwartungen mit Bundestagskandidaten Florian Fahrtmann (SPD) und Artjom Pusch (CDU)
Wie immer, wenn eine Bundestagswahl ansteht, geht es vor allem um eines: Wahlversprechen.
Die einen versprechen etwas, um gewählt zu werden, die anderen versprechen sich etwas von demjenigen, dem sie ihre Stimme geben. Doch wie wäre es, wenn man statt der Versprechen das Sprechen in den Vordergrund stellte? Miteinander sprechen und dadurch die eigenen Erwartungen, Probleme und Lösungsansätze mitteilen!
Genau dafür gab es am Montag, den 10. Februar 2025, im Harzklinikum in Quedlinburg die Gelegenheit. Die beiden Bundestagskandidaten Florian Fahrtmann (SPD) und Artjom Pusch (CDU) trafen sich mit Trägervertretern und Pflegekräften aus dem Landkreis Harz, um sich deren fachlichen und täglichen Erfahrungen zum Thema Pflege anzuhören und nach der Wahl in den Bundestag zu bringen.
Eingeladen zu dieser Gesprächsrunde hatten der AWO Kreisverband Harz e.V., das Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben, der Care Campus Harz, das Diakonische Werk Halberstadt, die Stiftung Schloß Hoym, die Stiftung Neinstedt und das Cecilienstift Halberstadt.
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des AWO Kreisverband Harz e.V., Kai-Gerrit Bädje, blickte Anke Schleritt, Prokuristin der AWO, auf die letzten zehn Jahre zurück, was sich in dieser Zeit alles in der Pflege verändert hat und welche neuen Anforderungen daraus resultierten. So sorgte zum Beispiel in den 2015er Jahren eine Verbesserung der Personalausstattung in der Sozialen Betreuung dafür, dass es plötzlich vermeintlich ganz viel Personal gab. Leider war dem nicht so. Eine weitere einschneidende Veränderung war die Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade. Während früher der tägliche Pflegeaufwand in Minuten als entscheidendes Kriterium herangezogen wurde, entscheidet bei den Pflegegraden der Grad der Selbständigkeit und Mobilität. Ziel dabei war und ist es, Demenz und psychische Erkrankungen nicht mehr gegenüber körperlichen Einschränkungen zu benachteiligen. Für Menschen mit diesen Erkrankungen war es in den Pflegestufen aufgrund ihrer oft erst spät oder gar nicht einsetzenden körperlichen Einschränkungen schwierig, eine angemessene Einstufung zu erhalten. Die Umstrukturierung von Pflegestufe auf Pflegegrad gestaltete sich nicht bei jedem Patienten reibungslos, was Anke Schleritt mit einem Praxisbeispiel anschaulich beschrieb.
2015 brachte eine sehr erfreuliche Änderung zur Ausbildung der Fachkräfte in der Pflege mitsich, denn es begann eine fast duale Ausbildung, also gut abgestimmte Praxis- und Theorieanteile Dafür hatte auch die AWO schon lange gekämpft.
Immer wieder für das ein oder andere Ungemach sorgte in den vergangenen zehn Jahren hingegen der Medizinische Dienst, kurz MD. Dessen Aufgabe ist es, sich für eine gute und gerechte Gesundheitsversorgung der Menschen einzusetzen und somit die Qualität einer Pflegeeinrichtung oder eines Pflegedienstes zu prüfen. Allerdings sei es in der Vergangenheit immer wieder zu der Situation gekommen, dass der Medizinische Dienst hauptsächlich kritisierend und wenig bis gar nicht beratend in Erscheinung trat, was als nicht hilfreich und zielführend empfunden wurde.
Doreen Krüger, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Halberstadt, beklagte in diesem Zusammenhang vor allem, dass alles stets doppelt und dreifach kontrolliert würde, was zu einer großen Datenansammlung führe. Erfreulich sei daran nur, dass heute hauptsächlich am PC dokumentiert werde und es dadurch weniger Papiermengen gäbe.
Im Moment würden auf eine Pflegekraft von den acht Stunden täglicher Arbeitszeit etwa drei Stunden rein für die Dokumentation anfallen. Wären es nur zwei Stunden tägliche Dokumentation, könnten insgesamt 47.000 gearbeitete Stunden mehr für Pflegeaufgaben genutzt werden. Mehr Dokumentation führe zwar nicht zu mehr Wohlbefinden der Bewohner, jedoch sehe der Medizinische Dienst nicht verschriftlichte Tätigkeiten als nicht erbrachte Leistungen. Auch bei völlig korrekter Pflege, gelte ein Bewohner dann als nicht versorgt.
Als Maßnahme gegen ungerechtfertigte Bewertungen und Kritiken seitens des MD erwägt die AWO laut Kai-Gerrit Bädje künftig eine Begleitung durch einen Anwalt oder mitlaufender Kamera.
Pflegestandards und Personalstrukturierung waren weitere Hürden, die es zu bewältigen galt. Dafür hatte sich die AWO sehr viel Zeit genommen, um mit den zu Pflegenden, deren Angehörige und dem Personal Wege zu finden, um den Menschen gerecht werden zu können. Dabei sei berücksichtigt worden, dass Menschen verschiedener Altersklassen auch verschiedene Anforderungen haben. So bevorzugten es ältere Menschen, wenn man sich ihnen zuwendet und mit ihnen kommuniziere. Dazu zähle auch die Unterstützung beim Thema selbstbestimmtes Sterben.
Im Januar 2020 wurde die dreijährige generalistische Pflegeausbildung eingeführt. Die Auszubildenden lernen dabei, Menschen aller Altersstufen in allen Fachbereichen zu begleiten und versorgen. Da die Absolventinnen und Absolventen nach der Ausbildung in allen Versorgungsbereichen der Pflege arbeiten können, stehen ihnen vielfältige Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten offen. Von diesem einheitlichen Startpunkt aus, können nun verschiedene Spezialisierungen angestrebt werden, was nach Ansicht von Anke Schleritt eine positive Veränderung sieht.
Rückblickend auf das Jahr 2022 tritt das Pflegereformgesetz auf den Plan und seit 2023 gibt es den neuen Ausbildungsgang zum Pflegeassistenten. Auch dieser könne ein Sprungbrett zu weiterführenden Spezialisierungen sein.
Allgemein könne festgestellt werden, dass Pflegekräfte und Behörden oft nicht auf einer Augenhöhe sind. Anke Schleritt wendet sich mit der Bitte an die Politik, den Fachkräften künftig mehr Fachlichkeit zuzugestehen, ihre täglichen Aufgaben kompetent ausführen zu können.
Florian Fahrtmann (SPD) erzählte im Anschluss aus seinem früheren Arbeitsalltag als Pfleger und verglich seine Erfahrungen mit der bisherigen Entwicklung. So habe es damals einen kaum spürbaren Unterschied im Gehalt einer Pflegefachkraft und Pflegeassistentin gegeben. Mit einem Stundenlohn von 26 bis 30 Euro sei man heute bereits auf einem guten Weg.
Weniger begeistert zeigte Fahrtmann sich über die Entwicklung, dass Auszubildende im Pflegebereich oft zu wenig Praxisalltag kennenlernen. So fehle es in der Pflege oftmals nicht an Nachwuchs, sondern an Fachkräften, die auch in ihrem erlernten Beruf blieben. Demnach würde sich in der generalistischen Ausbildung ein Großteil des ersten Ausbildungsjahres um Kommunikation drehen. Frühe habe man zu diesem Zeitpunkt noch Anatomie, Medikamentenlehre und Pflegeplanung gelehrt. Eine anschließende Professionalisierung über weitere zwei Ausbildungsjahre sei laut Fahrtmann unabdingbar, um die Fachkräfte auf den Praxisalltag vorzubereiten und unterstützt damit den Vortrag der AWO.
Zum Thema Ausbildung von Pflegekräften meldete sich auch Dr. Thomas Schilling, der Geschäftsführer der Care Campus Harz gGmbH zu Wort. Für ihn sei es alarmierend, dass in naher Zukunft viele Fachkräfte in Rente gingen und immer mehr Pflegekräfte in der Eingliederungshilfe beziehungsweise in der Heilerziehungspflege eingesetzt würden, obwohl sie woanders mehr gebraucht würden.
Zwar steige die Zahl der Ausbildungsverträge nach einem Abfall im Jahr 2022 wieder, dennoch konnte der Wert von vor der Generalistik bisher nicht wieder erreicht werden. Schilling berichtet außerdem von der Erfahrung, dass es heute einen größeren Druck gebe, Azubis einzustellen. Würde heute so gut wie jeder genommen werden, der sich für den Beruf interessiere, hätte man früher genauer auf Noten und/oder persönliche Qualifizierungen geschaut. 25% aller Lehrlinge beenden ihre Ausbildung demnach nicht.
Denn, und auch das erlebe Schilling immer häufiger, viele Auszubildende gehen mit einer unrealistischen Erwartung in den Beruf. Aufgrund Personalmangels gäbe es auch nur unzureichende praktische Begleitung. Dadurch käme es zu einer Praxisverzerrung. Thomas Schilling wünsche sich mehr psychosoziale Begleitung für Berufsschüler. Die Pflegekompetenzen sollten erweitert werden. Dadurch würde auch der Pflegeberuf an Attraktivität gewinnen. Die Kompetenzerweiterung sollte politisch gefördert werden, nicht die Bürokratie.
Ronny Rösler, der Pädagogisch-Diakonische Vorstand der Evangelischen Stiftung Neinstedt, wünscht sich ebenfalls weniger Bürokratie, denn dieser Mehraufwand würde die Pflegekräfte massiv belasten.
Hierzu spricht sich der SPD-Direktkandidat dafür aus, die Digitalisierung in der Pflege weiter voranzutreiben. Während der Corona-Pandemie hatten sich auf diesem Gebiet notgedrungen viele Abläufe vereinfacht, zum Beispiel durch telefonische Begutachtungen. Dadurch könne ein Teil der Bürokratie abgebaut werden.
CDU-Direktkandidat Artjom Pusch merkte an, dass sich die Politik bei Gesetzesentwürfen weniger in Details verlieren und auf Vollständigkeit pochen sollten, sondern dabei Menschen zu Wort kommen lassen müssten, die mit dem jeweiligen Gebiet zu tun haben und wüssten, was die wichtigsten Punkte sind. Auch dadurch könne erreicht werden, bürokratische Hürden einzudämmen und Gesetze für alle Beteiligten verständlicher und nachvollziehbarer zu gestalten.
Kai-Gerrit Bädje äußerte sich im Anschluss zum Thema Leasingarbeitskräfte und betonte, dass die AWO auf diese Möglichkeit der Personalabdeckung nicht mehr zurückgreifen wolle. Demnach würden Leasingkräfte zwar doppelt so viel kosten, aber unterm Schnitt nicht einmal hälftig die notwendige und erforderliche Leistung erbringen. So werden z. B. Medikamentengabe und Dokumentation nicht von Leasingpersonal erbracht und bliebe beim Stammpersonal hängen. So füllen diese Arbeiter zwar den Dienstplan, könnten sich aber aussuchen, wann sie arbeiten wollen. Am Ende würden sich nur die Leasingarbeitsgeber daran bereichern. Auch Anreize für die Leasingkräfte, sich auf dem Weg der Pflege weiterzubilden, gäbe es kaum.
Für Florian Fahrtmann kämen Leasingkräfte auch nur in Betracht, wenn sie zwingend erforderlich sind, die Leistungserbringung nach Maßgabe des Gesetzes zu erbringen.
Die Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Halberstadt, Doreen Krüger, berichtete von ihrer Erfahrung mit Leasingkräften und schilderte, dass diese zum Beispiel an Wochenenden gar nicht zur Verfügung stünden. Somit sei die vermeintliche Lösung für Notfälle genau das eben nicht. Als bedenklich sehe sie auch die immer weiter steigenden Eigenanteile für die Bewohner.
Dr. Thomas Schilling vom Care Campus lenkte das Thema auch auf Freiwilligendienste, die seiner Meinung nach weiter gefördert werden sollten. Diese stärken junge Menschen in den Themen Demokratie und Sozialkompetenz. Außerdem resultiere aus einem Freiwilligen Sozialen Jahr oft ein Ausbildungsberuf.
Des Weiteren würde Schilling es begrüßen, verstärkt Fachkräfte im Ausland zu suchen und die Ausbildungszentren stärker zu vernetzen und digital aufzurüsten. Denn: »Pflege ist nicht konjunkturabhängig«, so Schilling.
Artjom Pusch sprach sich ebenfalls für ausländische Fachkräfte aus. Hierzu empfahl der CDU-Politiker, mit der Suche schon möglichst früh zu beginnen. Dann nämlich, wenn die zukünftigen Pflegekräfte sich noch in der Ausbildung befänden oder auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz seien. Allerdings, so betonte Pusch, sei es notwendig, dass das ausländische Pflegepersonal deutsch lerne. Außerdem stellte Pusch die Frage in den Raum, ob den Pflegeeinrichtungen mit der Einführung eines Pflichtgesellschaftsjahres geholfen wäre. Dieses würde in etwa einen Ersatz zum früheren Zivildienst beziehungsweise eine Ergänzung zum Bundesfreiwilligendienst/Freiwilligen Sozialen Jahr darstellen.
Kai-Gerrit Bädje reagierte auf diese Frage mit der Aussage, dass ganz viele Bereiche in der Gesellschaft nur noch durch das Ehrenamt funktionieren würden. So habe sich der Bundesfreiwilligendienst als unverzichtbar erwiesen. Was Fachkräfte aus dem Ausland betrifft, sprach sich der AWO-Geschäftsführer klar dafür aus, anderen Ländern nicht deren Fachkräfte wegnehmen zu wollen.
»Andere Länder sollten nicht für unsere Fehler bluten«, betonte auch Prokuristin der AWO, Anke Schleritt. So sei es auch für sie zielführender, bei der Fachkräftesuche viel früher anzufangen und nicht bereits berufstätige Menschen aus ihrem Arbeitsumfeld zu holen.
Zum Thema Sprachen erlernen würde es Schleritt begrüßen, wenn die Fachkräfte durch einen Sprachlehrer während des Praxisalltags begleitet würden, sozusagen ein Sprachkurs am Bett. Denn es sei »wichtiger, dass der tägliche Austausch funktioniere, als die korrekte Grammatik“.
In diesem Zusammenhang appellierte Anke Schleritt an alle Anwesenden, das Wort Ausländer künftig weniger zu benutzen, denn »Menschen reden mit Menschen über Menschen.«
Florian Fahrtmann betonte, dass die Gesellschaft eine Menge von der Pflege lernen könne und hielt es ebenfalls für eine gute Idee, über die Einführung eines Pflichtjahres nachzudenken. Denn das Klischee, Pflege könne jeder, sei nicht richtig. Nicht jeder könne das leisten, was in den Einrichtungen Tag für Tag geleistet würde. Durch ein solches Jahr sehe der SPD-Kandidat eine große Chance für all diejenigen, die sich unsicher beim Thema Pflegeberufe sind, sich einmal in solchen auszuprobieren und vielleicht sogar weiter auf diesem Weg zu gehen.
Thomas Schilling vom Care Campus ergriff noch einmal das Wort, um über seine Erfahrungen in der Pflegeausbildung von vor der politischen Wende zu berichten. Auch damals gab es bereits Ausbildungsinhalte, die später in der Praxis kaum bis gar nicht angewendet werden konnten oder mussten. Dahingehend sei eine praxisorientiertere Ausrichtung wünschenswert. Pflege werde in Zukunft einen immer größeren Bedarf haben. Nicht nur, weil die Menschen immer älter werden, sondern auch weil bestimmte Krankheiten dies erfordern. So würden bis 2034 1,74 Millionen Pflegefachkräfte benötigt.
René Strutzberg von der Stiftung Schloß Hoym appellierte an die Politik, bei der Umsetzung von Gesetzen zugunsten der Pflege schnell und mit gesundem Menschenverstand zu agieren.
Für die beiden Bundestagskandidaten Artjom Pusch (CDU) und Florian Fahrtmann (SPD) war der Abend eine aufschlussreiche Veranstaltung und beide Politiker konnte viel mit auf den Weg gegeben werden, damit sie das Thema Pflege weiterhin im Blick behalten und bei künftigen Entscheidungen die Bedürfnisse aus der Pflegepraxis berücksichtigen können.
Mandy Politz
Fachassistentin der Geschäftsführung